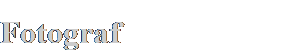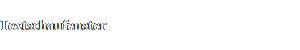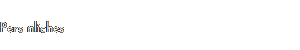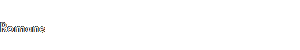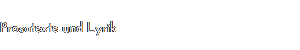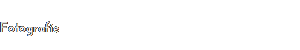|
Zum Konzept eines literarischen Fotobuchs
„Im großen Kampf zwischen den Augen und der Sprache hat der Blick die größere analytische
Kraft.“ Dieser Satz, von Jean-Luc Godard anlässlich der Verleihung des Adorno-Preises 2011 ausgesprochen, benennt das Spannungsfeld, in dem auch ein literarisches Fotobuch angesiedelt ist. Und wirft die Frage
auf, welche Kommunikationsform die größere Fähigkeit besitzt, die bewegte Geschichte einer Stadt wie Berlin zu vermitteln?
Sicherlich, die Aussage des Großmeisters der Novelle Vogue bezieht sich vor allem auf
dessen bevorzugtes Medium, den Film. Bewegte Bilder, unterlegt mit Sprache, wirken zweifelsohne anders als – statische! - fotografische Abbildungen oder Texte. Trotzdem weisen sie eine grundsätzliche
Gemeinsamkeit auf: Anders als Sprache, die kulturell festgelegte Verständigungssymbole benutzt und einer Rückübersetzung in die Gedankenwelt des Rezipienten bedarf, wirken bewegte wie auch „eingefrorene“
Bilder unmittelbar, indem sie assoziative – innere - Bilder erzeugen (auch wenn diese von den Intentionen und dem subjektiven Blick des Fotografen oder Kameramanns konnotiert sind).
Die Intention meines
fotografischen Berlin-Langzeitprojekts, das ich bereits in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts begonnen hatte, war allerdings von keinerlei theoretischen oder philosophischen Fragestellungen geprägt. Es
beruhte ganz einfach auf einem Bedürfnis nach Zeitlosigkeit, was in einer Stadt des permanenten Wandels bedeutete, die Etappen, deren Zeitzeuge ich werden konnte, aus dem unmittelbaren Geschehen heraus mit der
Kamera festzuhalten. Prägend hierfür waren die Fotografien von Heinrich Zille, die mit ihrer posthumen Veröffentlichung nicht nur das alte, untergegangene Berlin der Vor-Vorkriegszeit wieder lebendig werden ließen,
sondern sie setzten auch dem proletarischen Milieu ein Denkmal, dessen Überreste in meinem langjährigen Wohnquartier am Klausenerplatz in Charlottenburg noch bis in die frühen Achtzigerjahre zu besichtigen waren.
Worauf beruhte die Faszination der Zilleschen Fotografien? War es die nostalgisch angehauchte
Sehnsucht nach der Zeit vor den großen Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts? Oder das Bedürfnis des Neu-Berliners, dem Mythos einer Stadt auf die Spur zu kommen, der Platz-an-der-Sonne-Streben und Größenwahn so
tiefe Wunden geschlagen hatten?
Vermutlich habe ich in all den Straßenszenen, liebevoll portraitierten Stadtquartieren und Momentaufnahmen seiner Bewohner, immer instinktiv die Brücke zur Jetztzeit gesucht. Ob
auf dem Wochenmarkt am Klausenerplatz, bei Straßenfesten in meinem Wohnumfeld oder Streifzügen durch die Hinterhöfe der Altbauquartiere, stets drängten sich die Zille`schen Bilder als stille, aber unabweisbare
Referenz auf. Ganz besonders in den Gegenden, deren Gesicht durch die Kriegs- und Nachkriegszerstörungen eine komplette Neugestaltung erfahren hatte. Und durch die Teilung.
Es grenzte ja an Realitätsverweigerung,
aber selbst in den Jahren, als es nicht nur in linken Kreisen angesagt war, die DDR mit ihrer Hauptstadt im Ostteil der Stadt als etwas historisch Zwangsläufiges, ja Unveränderliches anzusehen, blieb Berlin
für mich eine Einheit. Und seine Zweiteilung etwas Vorübergehendes (auch wenn man das angesichts der in Mauer und Stacheldraht gegossenen Gegebenheiten kaum zu hoffen wagte!).
Einer der wenigen Intellektuellen,
die den Mut zur öffentlichen Manifestation einer solchen Haltung aufbrachte, war der Berliner Schriftsteller Peter Schneider. Sein 1982 veröffentlichter essayistischer Roman „Der Mauerspringer“ setzt gleich
auf den ersten Seiten mit einem großartigen Bekenntnis zu Berlin als einheitliches Ganzes ein. Mit einem visionären Blick aus dem Flugzeug, auf all die künstlich zerschnittenen Straßenzüge und Wohnquartiere, der
eine Haltung jenseits aller ideologischen Fesseln und pragmatischen Anleihen an die Tagespolitik offenbarte. Der Text hat mir allerdings mit schmerzhafter Deutlichkeit die Grenzen der Fotografie als
künstlerisch-dokumentarisches Medium vor Augen geführt.
Denn kann man ein Bild zum Sprechen bringen? Ich meine, nur über die Assoziationen, die es beim
Betrachter hervorruft. Und durch das Wissen über den historischen Kontext, in dem es entstanden ist. Insbesondere fotografische Bilder, die vorgeben, getreue Abbilder der auf ihnen sichtbaren Realität zu sein, geben
über das Geschehen, das ihnen zugrunde liegt, nur das preis, was wir in sie hinein interpretieren. Aber können sie Geschichten erzählen, Einsichten vermitteln, das erlebende Ich spürbar machen, wie es Peter
Schneider mit dem „Mauerspringer“ so überzeugend gelungen ist? Diese Einsicht hat bewirkt, meine Fotoaktivitäten mit Tagebuchnotizen, Kurzgeschichten und essayistischen Texten zu begleiten (wovon nicht zuletzt
mein 2008 erschienener Roman „Wenderomanze“, eine Ost-West-Liebesgeschichte aus der Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, profitierten konnte).
Womit ich wieder zur eingangs aufgeworfenen
Fragestellung zurückkomme. Besitzt der Blick wirklich die größere analytische Kraft? Oder spricht hier der Filmemacher und dessen Misstrauen gegenüber der Sprache mit all ihren Möglichkeiten zur Täuschung und
subjektiven Färbung? Dem möchte ich entgegenhalten, dass Bilder, selbst wenn sie von großer Aussagekraft sind, niemals allein aus sich heraus einen Sachverhalt vollständig zu erhellen vermögen. Deshalb hat man
bereits in der Stummfilmära den Bildern erklärende Texte zur Seite gestellt, und auch in den Naturwissenschaften ist es längst gang und gäbe, die zu vermittelnden Sachverhalte mit Texten und Bildern
darzustellen. Nicht nur, weil ein Bild mehr aussagen kann als tausend Worte, sondern eine rein sprachliche Schilderung häufig zu umständlich, missverständlich, und oft auch mit mehr als tausend Worten nicht
ausreichend wäre. Und umgekehrt bliebe bei einer rein bildhaften Darstellung zu Vieles „ungesagt“, zu ungenau, eben unvollständig.
Deshalb mein Plädoyer für eine Verschmelzung der beiden
Kommunikationsformen. Um die Vorzüge jeder Seiten ins Spiel zu bringen: die Ergänzung der sinnlichen Unmittelbarkeit von Bildern mit der präzisen Fähigkeit der Sprache zur Reflexion. Das aus dem eingangs erwähnten
Langzeitprojekt hervorgegangene Fotobuch „Berliner Metamorphosen“, das zu einer Reise durch vier Jahrzehnte Berliner Stadtgeschichte einlädt, basiert auf diesem Konzept. Jedem Abschnitt ist ein Erzähltext
vorangestellt, mit dem die bildhafte Erzählung der Fotografien eine Vertiefung durch die gedanklichen Reflexionen des Autors erfährt.
© Gottfried Schenk 2014
|